Diskurs 6 Minuten Lesedauer
Lieber Dr. Jan Brachmann,
ich habe Fragen an Ihren am 14.11.2025 erschienen FAZ-Artikel „Beethoven Made in China“.
Beethoven Made in China. Der Titel eröffnet Assoziationsketten, denen ich nicht recht bereit bin zu folgen: Labubus kommen aus China, Temu und Shine fluten mit unnötigem, fragwürdig produziertem Plunder den Markt und VW hat in Xinjang sehr umstritten Autos bauen lassen. „Beethoven Made in China“ soll das nach billigem Plastik riechen und ein bisschen nach Menschenrechtsverletzungen klingen? Oder spielt der Artikel darauf an, dass China der Erfindernation Deutschland davonrennt, die CO² neutrale Energieproduktion ausbaut und hier und da glänzende Kulturbauten in gigantischen Dimensionen aus dem Boden stampft? „Beethoven Made in China“ klänge dann also zukunftszugewandt? Ich habe den Eindruck, Sie tendieren zur erstgenannten Variante, wenn Sie in der Folge fragen „Wenn man sich für Kunst und Bildung schämt, hat dann das klassische Musikleben Europas noch eine Zukunft?“
Ich finde leider im Text darauf keine Antwort, denn mich würde es brennend interessieren, wer genau sich für Kunst und Bildung in Europa schämt – und noch spannender fände ich es, Ihre Vision von einer Zukunft des klassischen Musiklebens in Europa zu erfahren. Darüber schweigt der Text, stattdessen lese ich, dass Sie die Häufung asiatischstämmiger Preisträger:innen von europäischen Musikwettbewerben und bei deutschen Orchestervorspielen beklagen. Und hier fange ich an, mich etwas unwohl beim Lesen zu fühlen: Asiatischer Fleiß, Romanische Ritterlichkeit, deutsche Satt- und Faulheit… Da hätte ich mir von Ihnen, lieber Herr Dr. Brachmann, ein wenig mehr Differenzierung erhofft. Für uns Geisteswissenschaftler steht zwar Empirie nicht so häufig auf den Studienplänen, aber ein Nachweis darüber, dass Nationen (oder ganze Kontinente) per se spezifische Charaktermerkmale ausprägen, ist meines Wissens nie wissenschaftlich belegt worden. Für das leistungsorientierte „sowjetische System“ führen Sie Garanca, Nelsons, Trifonov und Grigorian auf. Meine Gegenbeispiele könnten Diana Damrau, Andreas Schager, Isabelle Faust oder Vikingur Ólafsson sein – zudem könnte man das „finnische Dirigierwunder“ anführen: üblicherweise sind skandinavische Bildungssysteme nicht für harten Drill bekannt.
Sollten Sie mit Ihrem Text den Wettbewerbszirkus und Orchesterauswahlverfahren als solche hinterfragen, finden Sie in mir einen leidenschaftlichen Mitstreiter. Denn ist es wirklich angemessen, in undurchsichtigen Jury-Entscheidungen nach komplett intransparenten Kriterien Preisträger:innen (ganz unabhängig von ihrer Herkunft) zu küren? Qualifiziert das fehlerfreie, mehr noch, brillante Spiel hinter dem Vorhang wirklich für die Teamaufgabe Orchester? Ich bezweifle das – und bin damit nicht allein. Die Orchester selbst bemühen sich teils darum, ihre Einstellungs-Kriterien neu zu denken.
Und nun muss ich Ihnen wirklich vehement widersprechen. „In den öffentlichen Musikschulen nehmen die Förderung von Diversität, Inklusion und jugendlichem Wohlbefinden beim Musizieren einen größeren Raum ein als der Leistungsdruck potentieller Berufsvorbereitung.“ kritisieren sie. Hier erinnere ich Sie gerne daran, dass das Recht auf Kulturelle Teilhabe über das Unesco Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen verbrieft ist, das durch Deutschland im Jahr 2007 ratifiziert wurde. Eine staatliche Musikschule, die Inklusion und Diversität nicht förderte, handelte also gegen geltendes Recht – das kann sich niemand wünschen. Und was meinen Sie mit „jugendlichem Wohlbefinden“? Und warum ist das schlecht? Überhaupt fällt es mir schwer, Ihrer Argumentation mit Blick auf Musikalische Bildung zu folgen. Einerseits beklagen Sie Inklusion, andererseits stellen Sie fest, dass für Kinder aus Familien bildungsfernerer Schichten ein Erstkontakt mit klassischer Musik kaum noch möglich sei. Aber wären nicht inklusive und vielfältige Angebote in subventionierten (und damit verhältnismäßig erschwinglichen) Musikschulen genau ein möglicher Kontaktpunkt für Erstbegegnung? Unbestritten, im Bereich Musikalische Bildung ist einiges im Argen, aber ein zu viel an Inklusion kann ich beim besten Willen in der Landschaft nicht ausmachen. Der Deutsche Musikrat widmet diesem Komplex genau deswegen eine ganze Reihe von Online-Formaten, die im März 2026 im Kongress Musikalische Bildung im Ökosystem Musik münden wird.
Etwas weiter in ihrem Text beschreiben Sie, dass die Produzenten klassischer Musik unter einem hohen Rechtfertigungsdruck stünden und daher mit Hilfe von Komplexitätsreduktion nach neuen Konsument:innen fischen. Diese Kritik ist so alt, wie die Reproduktionsmöglichkeiten von Musik – und in den vergangenen hundert Jahren ist deswegen weder ein Rundfunkorchester noch ein Opernchor abgewickelt worden. Ich hoffe im Übrigen, dass Sie das Menschenbild hinter dem Begriff der „Konsumentendemokratie“ kritisch hinterfragen – und ihn nicht bloß benutzen, um den Konsument:innen wortgewaltig schlechten Geschmack zu unterstellen. Edward Bernay prägte den Begriff in den 1930er Jahren, mit der Vorstellung, dass „gesellschaftliche Eliten die Kontrolle über das Gemeinwesen behalten müssten, während die „Massen“ in der Illusion leben sollten, über den Konsum die Kontrolle über ihr eigenes Dasein zu gewinnen“. Eine solche Vorstellung von aus dem Hintergrund lenkenden Eliten führt aktuell zu fürchterlichem Verschwörungsraunen, das einer gelebten Demokratie sicherlich keinen Dienst leistet.
Zum Schluss möchte ich Ihrem Lamento aber gerne einen positiven Zukunftsausblick entgegensetzen: „Zeitgenossenschaft made in Gemeinschaft“. Das würde das Klassische Musikleben auch aus dem „Rechtfertigungsdruck“ befreien, bloß 7 – 10% der Gesellschaft zu interessieren. Dieser Ansatz setzt allerdings ein Loslassen von vertrauten Ritualen und große, ehrliche Neugierde voraus, die fest gefügten Systemen häufig eher schwerfällt. Ich habe keine Sorge, um unser Klassisches Musikleben. Auch wenn die Orchester heute schon anders aussehen als 1970 (weiblicher und internationaler zum Beispiel), haben sie doch nichts an ihrem künstlerischen und emotionalen Potential verloren. In meiner Vorstellung werden die Potentiale genutzt, die im Augenblick noch dadurch brachliegen, dass häufig an einem sich über Jahrzehnte kaum verändernden Kanon, einem sich seit über 100 Jahre nur wenig veränderndem Konzert-Ritual festgehalten wird. Ich bin davon überzeugt, dass ein Konzert- oder Opernhaus zu einem Ort der Stadtgesellschaft werden kann, der der Gemeinschaft Struktur, Wissen, höchste Professionalität im eigenen Tun und unfassbar viele kreative Potentiale zur Verfügung stellen kann und ich habe gar keinen Zweifel daran, dass Bach, Mozart, Beethoven weiter eine Rolle im Konzertleben spielen werden. Aber es gibt so viel mehr zu entdecken, das die von Ihnen gepriesene „Hochkultur des Komponierens“ (wer hat die eigentlich definiert und unter welchen Kriterien?) auf vielfältige und anschlussfähige Art erweitern kann. Einen Artikel dazu habe ich unter dem Titel Spielplätze und Freiräume im Magazin von Kulturmanagement.net veröffentlicht.
Schließlich glaube ich fest daran, dass sich Musiker:innen zunehmend selbst unterschiedliche Formen der Interaktion mit Publikum und Gesellschaft wünschen. Bei der Ideenwerkstatt des Tuned Netzwerks in Bochum waren dazu spannende Impulse zu erleben. Ich blicke also hoffnungsvoll in die Zukunft, auch – oder gerade weil – wir neben „Beethoven made in Vienna (designed in Bonn)“ auch die Variante „Beethoven made in China“ wählen können.
Ich freue mich auf Ihre Antwort und sende
Freundliche Grüße
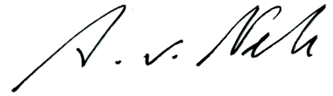
Netzwerk Junge Ohren
Geschäftsführung